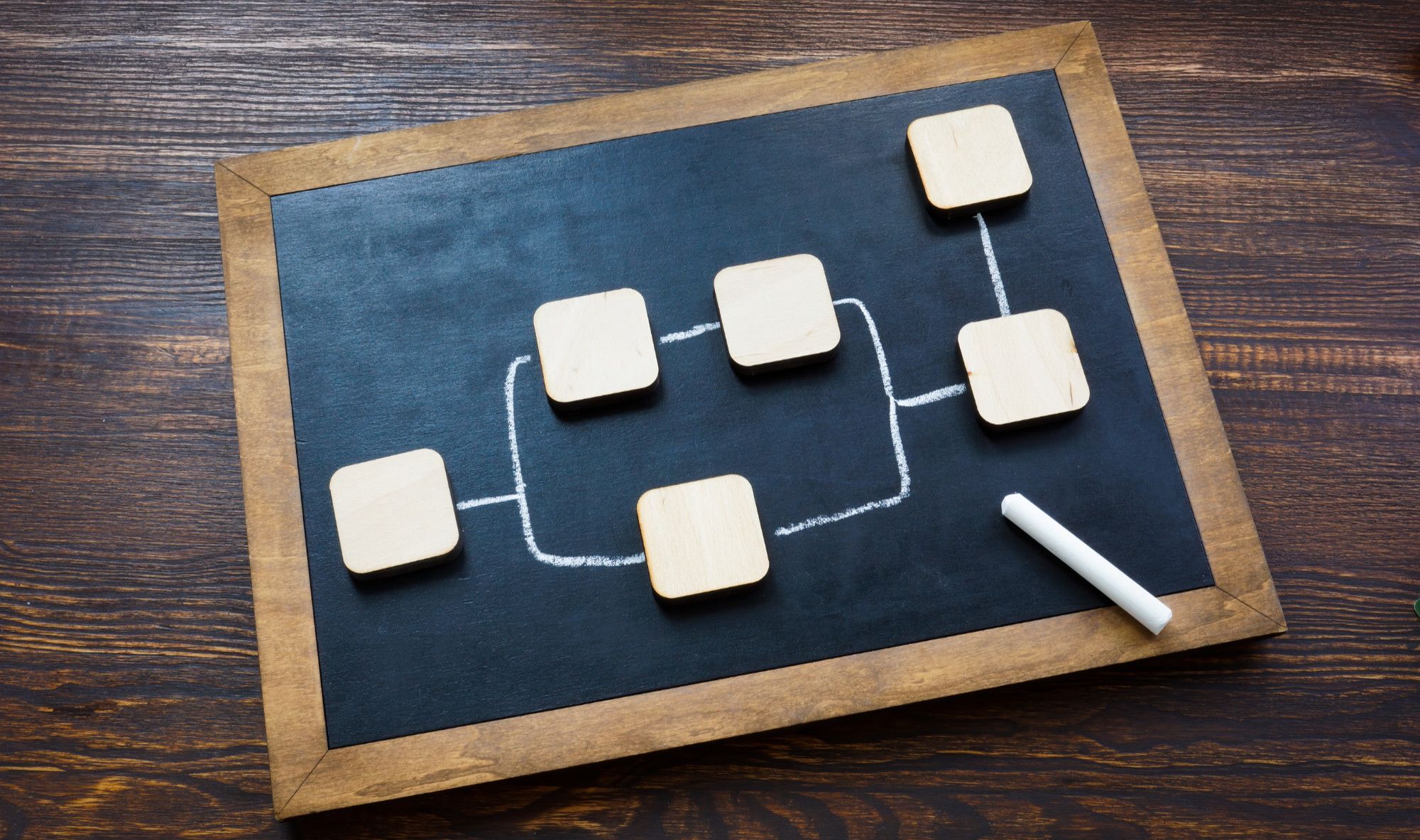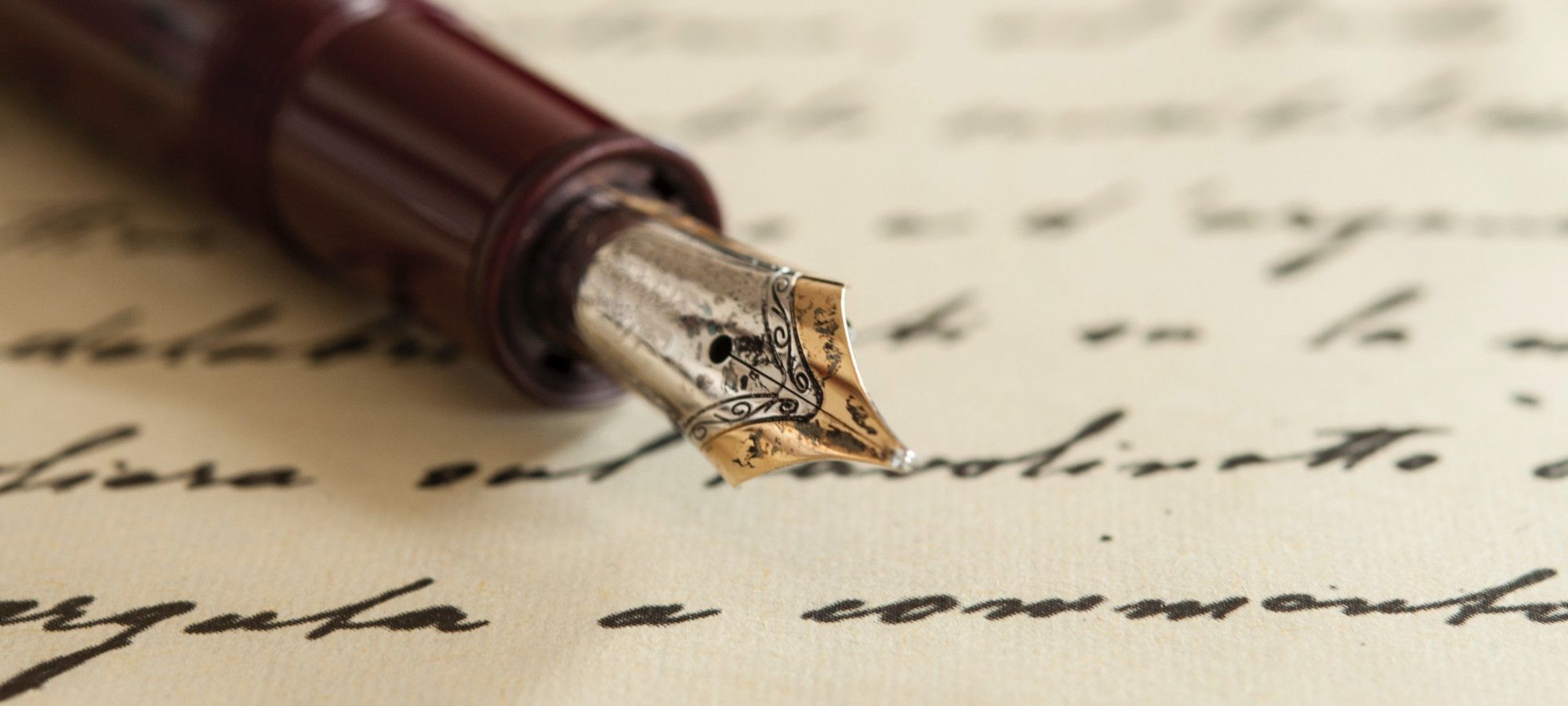Was ein Anwalt für Erbrecht kostet
Aus Sorge vor einer hohen Rechnung scheuen viele den Gang zum Anwalt. Um etwas Licht ins Dunkel zu bringen, erklären wir hier, welche Grundlagen es für die Berechnung von Anwaltsgebühren gibt, warum Rechnungen mal höher und mal niedriger ausfallen und wie Mandanten vor zu hohen Rechnungen geschützt werden.

Was ein Beratungsgespräch beim Anwalt für Erbrecht kostet
Man liest immer wieder, dass die Höhe der anwaltlichen Gebühren gesetzlich geregelt ist und dass die Höhe von 190 Euro zzgl. 19 % Mehrwertsteuer für eine anwaltliche Erstberatung nicht überschritten werden darf. Doch warum gibt es dann so viele Fälle, in denen die Rechnung des Anwalts deutlich höher ausfällt?
Grundsätzlich muss unterschieden werden, ob es sich um eine anwaltliche Erstberatung handelt oder nicht. Bei einer anwaltlichen Erstberatung wird ein Sachverhalt nicht bis ins letzte Detail erläutert. Vielmehr geht es vorrangig darum, die gesetzliche Grundsituation zu beleuchten, wenn auch mit Blick auf den konkreten Einzelfall. Geht ein Anwalt allerdings stärker auf den konkreten Sachverhalt ein, dann kann schnell die Beratungstiefe des anwaltlichen Erstgesprächs überschritten werden.
Wichtig zu wissen: Anwälte sind verpflichtet, Sie darauf hinzuweisen, wenn eine Erstberatung in ein intensives Einzelgespräch übergeht und die Kosten damit steigen. Sie haben dann die Wahl, ob Sie die detailliertere Beratung in Anspruch nehmen wollen oder nicht.
Kann von Vorteil sein: die Vergütungsvereinbarung
Anwälte, die auf der Basis ihrer Erfahrung einschätzen können, dass ein Anliegen nur in intensiven und tiefergehenden Beratungen besprochen werden kann, haben die Möglichkeit, von vornherein mit ihren Mandanten eine gesonderte Vergütungsvereinbarung über höhere Beratungskosten zu schließen. Eine solche individuelle Vergütungsvereinbarung ist jedoch nur dann wirksam, wenn neben der Mitteilung der höheren Gebühr auch eine Information zur Höhe der gesetzlichen Gebühr erfolgt, so dass ein Vergleich beider Gebührenvarianten möglich ist. Leider verzichten einige Rechtsanwälte – ob nun aus Bequemlichkeit oder aus anderen Gründen – darauf, detailliert über die unterschiedlichen Optionen aufzuklären.
Was nicht im Beratungsgespräch enthalten ist
Wie schon das Wort Beratungsgespräch sagt, ist die anwaltliche Tätigkeit ausschließlich auf die mündliche Erörterung begrenzt. Wer erwartet, eine schriftliche Zusammenfassung des Gesprächs zu erhalten, liegt falsch. In den Gebühren für ein anwaltliches Beratungsgespräch ebenfalls nicht enthalten ist die Prüfung von Dokumenten, beispielsweise eines Testaments, eines Erbvertrags oder eines Erbschafts- oder Schenkungssteuerbescheides vom Finanzamt. Hierfür werden sogenannte Prüfungsgebühren fällig, deren Höhe, wen wundert´s, ebenfalls gesetzlich geregelt ist. Ergibt sich in der Beratung, dass ein Anwalt aufgrund des besprochenen Anliegens ein Schreiben verfasst, so ist auch dieses Schreiben nicht in der Beratungsleistung enthalten. Allerdings erlassen Rechtsanwälte hier und da die Gebühren für die Beratung ganz oder teilweise, wenn im Anschluss an das Beratungsgespräch die Übernahme eines Mandats erfolgt.
Wie die Anwaltsgebühren berechnet werden
Das Gesetz, das die Vergütung anwaltlicher Leistungen regelt, ist das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, kurz: RVG. Es regelt die Gebühren für jede Form anwaltlicher Leistungen. Diese Gebühren richten sich in den meisten Fällen nach dem Regelungsgegenstand. Wird zum Beispiel ein Haus von den Eltern auf ihre Kinder übertragen, so entstehen für die Ausfertigung des Vertrages Anwaltsgebühren nach dem oben genannten Gesetz. Hat das Haus einen Wert von 500.000 Euro, so entstehen gesetzliche Anwaltsgebühren in Höhe von ca. 4.600 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer. Bei einem Wert von 1 Million Euro entstehen Gebühren in Höhe von 6.700 Euro zzgl. 19 Prozent gesetzliche Mehrwertsteuer. Hinweis: Obwohl der Wert im soeben genannten Beispiel 2 dem doppelten Wert des Beispiels 1 entspricht, beträgt die anwaltliche Gebühr nicht das Doppelte. Die Gebühr des Anwalts wächst nicht in gleichem Maße mit wie der Wert des Regelungsgegenstandes.
Wichtig zu wissen: Die Gesetze zur Vergütung anwaltlicher Leistungen wurden beschlossen und in Kraft gesetzt, um ein Unterschreiten der Gebührenhöhe zu verhindern. Steht also für bestimmte anwaltliche Leistungen ein Mindesthonorar fest, darf dieses nicht unterschritten werden. Das gilt für Anwälte ebenso wie für alle, die ein Anliegen nach deutschem Recht zu klären haben. Der Versuch, das anwaltliche Honorar herunterzuhandeln, scheitert also an den gesetzlichen Vorgaben.
Was ein Testament beim Anwalt kostet
Wer sein Testament beim Anwalt ausarbeiten lässt, stellt sich natürlich auch die Frage, mit welchen Kosten dies verbunden ist. Auch hier gibt es gesetzliche Gebührenvorgaben. Für die anwaltliche Erstellung eines einfachen Testaments hat der Bundesgerichtshof vor einigen Jahren eine Kappung der Gebühren verhängt. Diese liegt bei 1.000 Euro zuzüglich 19 % Mehrwertsteuer. Der Bundesgerichtshof geht in seiner Urteilsbegründung davon aus, dass die Erstellung eines einfachen Testaments für Juristen einen nur geringen gedanklichen Aufwand darstellt und daher diese Deckelung der Gebühren festgelegt.
Versteht man das Testament allein als Instrument der Verteilung, so ist diese Auffassung sicher richtig, doch gehört zu einer Testamentserstellung auch die Rückversicherung, dass das Testament die richtige Regelung für die Betroffenen darstellt.
Hierzu muss weit mehr als die bloße Verteilung geregelt werden. Es gilt zu prüfen, ob und inwieweit ein Testament die Erben in eine vermeidbare Steuerfalle führen kann und ob es nicht besser geeignete Instrumente der erbrechtlichen Absicherung von Angehörigen gibt. Diese Aspekte, die zu einer umsichtigen Erbplanung einfach dazugehören, hat der BGH nicht in seiner Urteilsfindung einbezogen, sondern lediglich auf den Erstellungsaufwand eines einfachen Testaments geachtet.
Anwaltskosten bei gerichtlichen Auseinandersetzungen
In gerichtlichen Auseinandersetzungen gilt ein ähnliches Prinzip wie bei außergerichtlicher Anwaltstätigkeit: Es wird geschaut, um was gestritten wird und dann kann der Gebührenwert einfach ausgerechnet werden. Die große Besonderheit in strittigen Verfahren ist nicht die Höhe der Anwaltsrechnung, sondern vor allem die Frage, wer am Ende diese Rechnung bezahlt. Wer einen Gerichtsprozess im Erbrecht verliert, zahlt nicht nur den eigenen Rechtsanwalt und die Gerichtskosten zu 100 Prozent, sondern hat zudem auch noch die Kosten für den Anwalt der Gegenseite zu tragen.
Es lohnt sich, einen Vergleich der Anwaltskosten zu machen
Unser Finanz-Tipp bei der Erbregelung:
Wie wir bereits an anderer Stelle ausführlich erklärt haben, gibt es im Erbrecht eine Faustregel: Je weniger Geld Sie in die Regelung des Erbes stecken, desto teuer wird der Erbfall für die Erben. Leider ist es in Deutschland gesetzlich so geregelt, dass Sie selbst bei der Erbregelung nur dann erhebliche Vorteile für die Erben erreichen können, wenn Sie die Hilfe und die Unterstützung von Anwälten und/oder Notaren in Anspruch nehmen. Sie selbst können weder eine Steuervermeidung noch die Vermeidung von Pflichtteilsansprüchen vornehmen. Wenn Sie schon Geld für die Regelung ausgeben, sollten Sie sicher sein, von Anfang an das Richtige zu tun. Unsere Empfehlung lautet daher: Gehen Sie kein Risiko ein. Lassen Sie sich über die Höhe der Kosten informieren. Wir zeigen Ihnen, in welchen Bereichen Sie einen Anwalt oder Notar benötigen und welche Kosten dann auf Sie zukommen werden, aber auch, welche Einsparungen Sie im Gegenzug durch unterschiedliche Regelungsmöglichkeiten bewirken können.
Unser Finanz-Tipp bei Erbstreitigkeiten:
Die Gebühren für Erbstreitigkeiten sind stets ärgerlich. Doch der Verlierer zahlt am Ende des gerichtlichen Verfahrens nicht nur seine eigenen Kosten, sondern auch die Kosten des gegnerischen Anwalts. Daher gilt: Wer sich in einer gerichtlichen Erbauseinandersetzung wiederfindet, sollte diese nicht leichtfertig einfach laufen lassen. Wir empfehlen Ihnen, zunächst die Erfolgsaussichten des Verfahrens einschätzen zu lassen. Die Risikoabwägung ist unerlässlich, denn bei jeder Auseinandersetzung gibt es sowohl Gewinner als auch Verlierer. Wollen Sie zu den Verlierern gehören? Nicht immer muss es auf eine gerichtliche Auseinandersetzung hinauslaufen. Zeichnet sich ab, dass ein Verfahren nicht gewonnen werden kann, gibt es zahlreiche außergerichtliche Strategien, den Schaden zu reduzieren. Es kann sich lohnen, auch diese Alternativen in die Überlegungen mit einzubeziehen.
Warum es trotz RVG Unterschiede in der Höhe der Gebühren gibt
Etablierte Anwälte bzw. Rechtsanwälte mit besonderen Kenntnissen liegen bei der Rechnungshöhe meist über den Gebührensätzen des RVG. Reputation und/oder Fachwissen ziehen naturgemäß eine höhere Nachfrage nach sich und das hat Auswirkungen auf die Gebührenhöhe. Doch es ist nicht alles Gold was glänzt. Es gibt Fälle, in denen das Auftreten wenig mit den tatsächlichen Fähigkeiten zu tun hat. Es empfiehlt sich daher, das Beratungsgespräch zu nutzen, um sich von der Arbeitsweise und nicht zuletzt vom persönlichen Engagement des Anwalts zu überzeugen und erst dann einen Mandatsauftrag zu erteilen.
Schutz von Mandanten vor überhöhten Rechnungen
Einerseits empfinden Mandaten die zu zahlende Rechnungshöhe häufig als zu teuer, anderseits handelt es sich bei anwaltlicher Arbeit um eine hochspezialisierte Tätigkeit, deren Auswirkungen von erheblicher Tragweite sind. Eine Gebührenregelung wirkt hingegen auch in die andere Richtung. Mandanten können sich gegenüber einem Anwalt auf die Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Abrechnungspraxis berufen und haben damit eine Grundlage zur Bewertung im Streitfall. In vielen anderen Branchen gibt es dergleichen Schutz nicht.
Gibt es zwischen Mandanten und Anwalt unterschiedliche Auffassungen zur Rechnungshöhe, ist die erste Anlaufstelle sicher die Schlichtungsstelle der jeweiligen Anwaltskammer. Mandanten haben die Möglichkeit, die Höhe der Rechnung prüfen zu lassen. Beide Seiten legen dann ihre Argumente für oder gegen die strittige Rechnungshöhe vor, die Schlichtungsstelle nimmt dann Stellung zur Höhe der Abrechnung. Für Mandanten ist dieser Service kostenfrei. Die Stellungnahme der Anwaltskammer ist dann zwar kein Urteil, wird aber von Anwälten in den meisten Fällen akzeptiert. Sollte das nicht der Fall sein, ist aber klar, wie ein Gerichtsverfahren ausgehen wird, sollte dieses notwendig werden.

Gebühren im Erbrecht
-
Grundsätzliches zu den Anwaltskosten: von der Erstberatung bis zur gerichtlichen Vertretung

Unsere Leistungen
-
Erstellen Sie einfach und kostenfrei Ihr Testament mit unserem Testamentsgenerator
-
Streit um Erbe und Pflichtteil: Wir helfen
Haben Sie Fragen?
Buchen Sie ein kostenfreies Beratungsgespräch mit unseren Nachlass-Experten:
Passende Webinare
Mehr zu diesem Thema

Testament oder Erbvertrag – was ist besser?
Weiterlesen
Der Rechtsanwalt für Erbrecht: Wenn ein Spezialist für Vermögensnachfolge notwendig wird
Weiterlesen
Erbrecht: Alles, was Sie zur Rechtsberatung wissen müssen
Weiterlesen
Vorerbschaft und Nacherbschaft, was bedeutet das im praktischen Alltag?
Weiterlesen
Nutzen Sie die kostenfreien Webinare von Testament-und-Erbe.de. Erfahrene Rechtsanwälte und Fachanwälte für Erbrecht Informieren Sie über die wichtigsten Aspekte bel der Regelung von Erbschaften, weisen auf häufige Fehler hin und helfen Ihnen, Angehörige abzusichern sowie Erbschaftssteuern zu sparen.