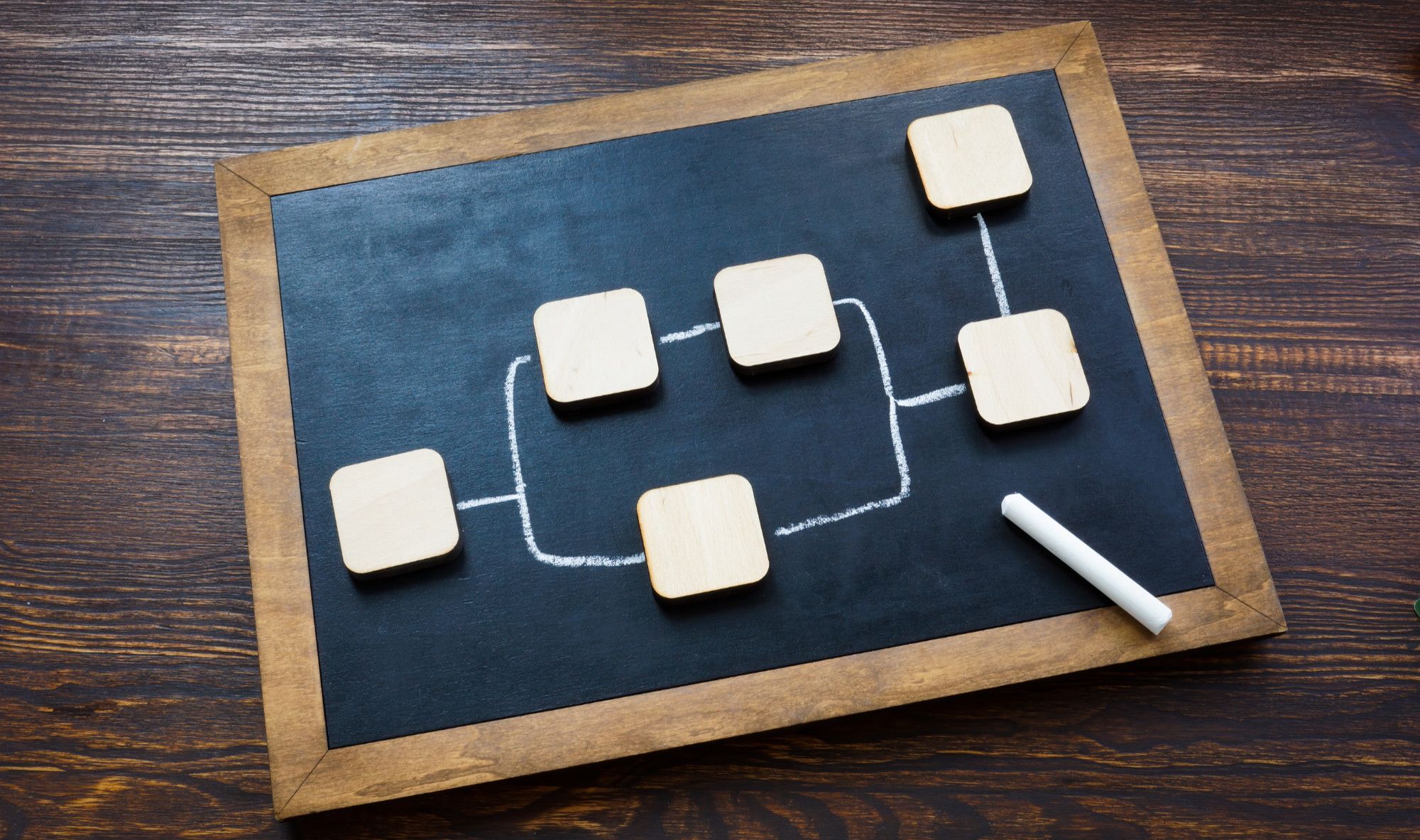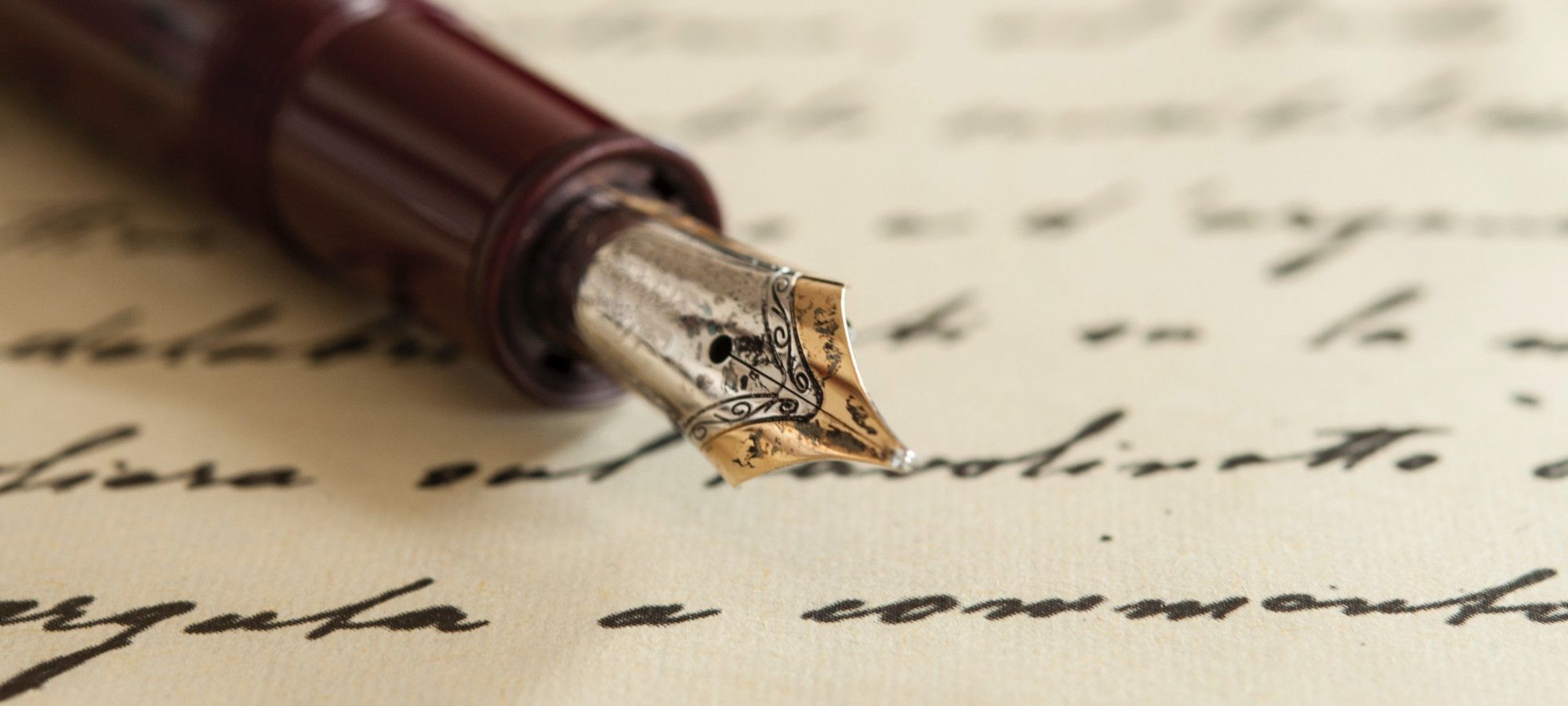Testament oder Erbvertrag – was ist besser?
Testament und Erbvertrag sind unterschiedliche Instrumente der Nachlassregelung, die man abhängig von der eigenen Situation und Zielsetzung einsetzen sollte.

Wer seinen Nachlass regeln will, kann auf unterschiedliche erbrechtliche Instrumente zurückgreifen. Besonders bekannt ist das Testament – es wird sehr häufig als Mittel der Erbverteilung gewählt. Was man mit einem Testament regeln kann und wo seine Grenzen liegen, erklären wir am besten an einem Beispiel:
Nachlassregelung per Testament
Die Eheleute Hilde und Kurt wollen ihren Nachlass regeln. Sie haben zwei Kinder, besitzen ein Häuschen, das beiden je zur Hälfte gehört und haben etwas Bargeld auf der Bank. Sie beschließen, ein Testament zu errichten. Hierzu schreiben sie auf, was nach ihrem Tod mit ihrem Vermögen geschehen soll. Sie legen fest, dass im Todesfall eines Ehepartners das Eigentum an der Immobilie auf den länger lebenden Ehepartner übergehen soll, die Kinder werden also auf den Pflichtteil gesetzt. Verstirbt auch der länger lebende Ehepartner, soll schließlich das Haus den Kindern zufallen. Fazit: Die Eheleute haben das Vermögen verteilt. Auf den ersten Blick scheint alles perfekt geregelt. Auf den zweiten Blick zeigt sich allerdings, dass die Eheleute bei ihrem Testament die Pflichtteilsproblematik nicht bedacht haben: Dem Gesetz zufolge steht den Kindern beim Tod eines Ehepartners die Hälfte des Erbteils als Pflichtteil zu. Dieser Anspruch bezieht sich zwar nicht direkt auf das Haus direkt, doch weil der Verstorbene ein Haus bzw. seinen Anteil an dem Haus hinterlässt, berechnet sich der Pflichtteilsanspruch aus dem Wert der Immobilie. Zur Veranschaulichung: Gehen wir in der Beispielrechnung davon aus, dass das Haus zum Zeitpunkt des Todes einen Wert von 600.000 Euro hat. Der Verstorbene hinterlässt also ein Vermögen von 300.000 Euro allein aus seinem Anteil an der Immobilie. Die gesetzliche Erbfolge sieht nun vor, dass 50 Prozent vom Erbe an den Ehepartner gehen. Die anderen 50 Prozent teilen sich die beiden Kinder. Der Ehepartner bekäme also 150.000 Euro, die Kinder jeweils 75.000 Euro. Nun haben die Eheleute aber verfügt, dass der länger lebende Ehepartner das gesamte Haus bekommen soll. In diesem Fall erhalten die Kinder einen finanziellen Ersatz in Höhe der Hälfte ihres ursprünglichen Anteils, den sogenannten Pflichtteil. Das bedeutet, dass der länger lebende Ehepartner einen Betrag von insgesamt 75.000 Euro an die Kinder auszahlen muss. Jedes Kind erhält somit 37.500 Euro als Pflichtteil. Diese Summe auszuzahlen, ist jedoch für die allermeisten Familien ein Riesenproblem. Was also tun?
Die Alternative: der Erbvertrag
Eine denkbare Lösung wäre, einen Erbvertrag abzuschließen. Dieser regelt zwar im Wesentlichen den gleichen Verteilungsweg des Vermögens, kann aber um konkrete Vereinbarungen erweitert werden: So könnten die Kinder im Erbvertrag auf den Pflichtteil verzichten. Damit wäre die Belastung für den länger lebenden Ehepartner vermieden, den Pflichtteil aus unserem Beispiel in Höhe von zweimal 37.500 Euro auszahlen zu müssen. Ein möglicher Vorteil für die Kinder wäre wiederum, dass ihnen durch den Erbvertrag das Erbe beim Tod des zweiten Ehepartners verbindlich zugesichert wird. Ein gut gemachter Erbvertrag bietet im Vergleich zum Testament also zusätzliche Gewissheit: Jeder weiß, was er zu tun hat und was er bekommt. Im Vergleich dazu ist das Testament alles andere als sicher, denn bei ihm handelt es sich um eine einseitige Erklärung, keine verbindliche Vereinbarung zwischen mehreren Beteiligten.
Pauschallösungen gibt es nicht
Sie haben gesehen, welche Probleme auftauchen können (nicht müssen). Ein pauschales Urteil, ob ein Testament oder ein Erbvertrag die bessere Regelung darstellt, lässt sich aus dieser kurzen Problemschilderung aber nicht ableiten, denn auch mit einem Erbvertrag lassen sich nicht immer alle wichtigen Punkte wie zum Beispiel steuerliche Aspekte oder der gemeinsame Umgang der Erben mit der Immobilie in Krisenzeiten festlegen. Da Familien- und Vermögenssituationen sehr unterschiedlich sein können und individuelle Lösungen erfordern, empfiehlt sich stets ein anwaltliches Orientierungsgespräch.
Anwalt oder Notar?
Wichtig: Notare dürfen aufgrund ihrer Berufsordnung keine Interessenvertretung vornehmen. Zu ihrem Aufgabenbereich gehören Beurkundungen, z.B. von Testamenten, Erbverträgen, nicht jedoch die Beratung für die Entscheidungsfindung, die Optimierung der erbrechtlichen Wünsche oder die steuerlichen Folgen. Vor dem Gang zum Notar sollte man daher eine anwaltliche Beratung in Anspruch nehmen.

Werkzeuge und Leistungen
Erstellen Sie einfach und kostenfrei Ihr Testament mit unserem Testaments-Generator
Alles richtig gemacht? Wir prüfen Ihr Testament
Berliner Testament oder gesetzliche Erbfolge? Steuerbelastung vergleichen

Informationen rund ums Testament
-
Wenn ein normales Testament nicht ausreicht: Sonderformen letztwilliger Verfügungen
-
Was ist das beste Regelungs-Instrument? Optimale Absicherung mit Immobilien
Fragen zum Testament?
Buchen Sie ein kostenfreies Beratungsgespräch mit unseren Nachlass-Experten:
Passende Webinare
Mehr zu diesem Thema

Das Testament - die klassische Erbfolgeregelung
Weiterlesen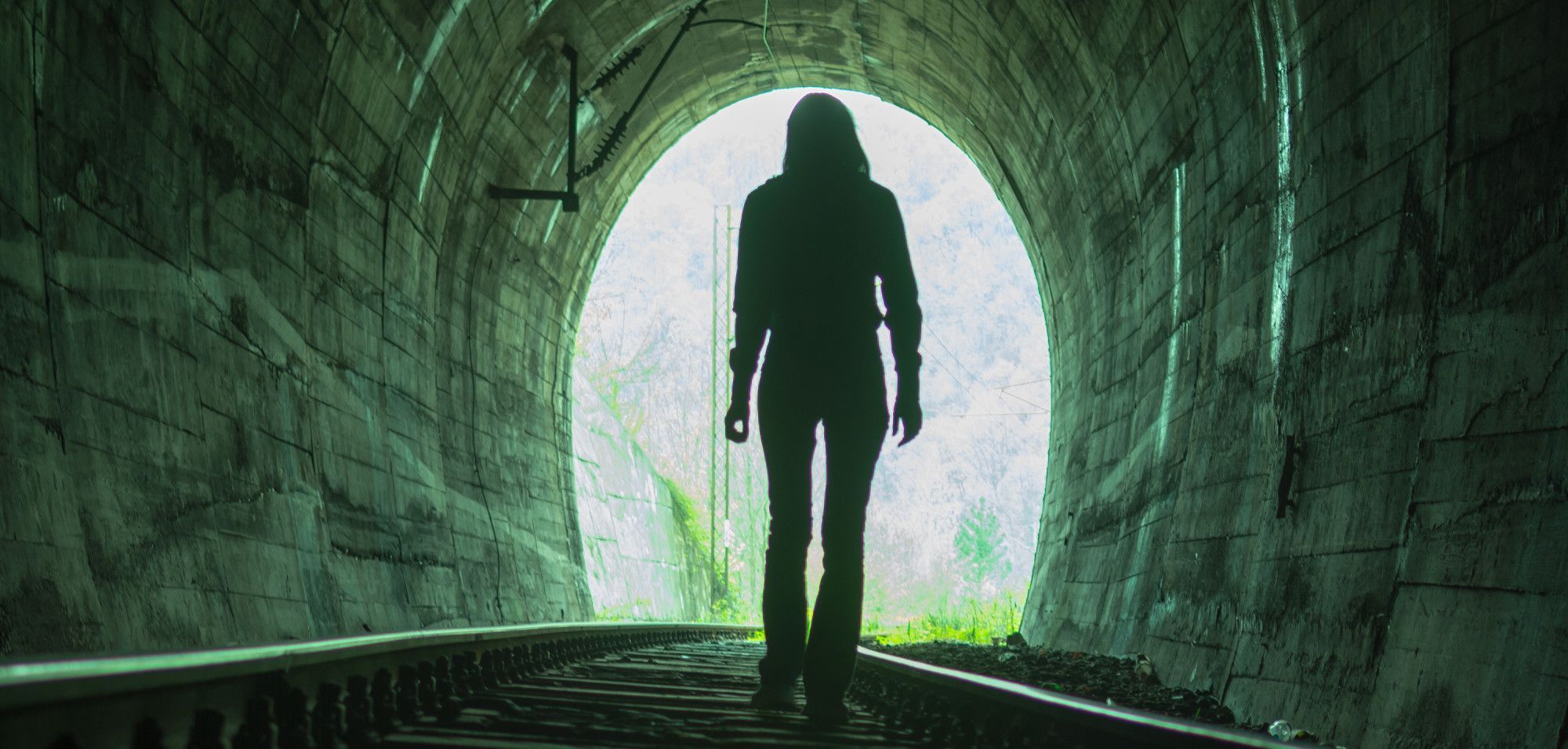
Du bist enterbt! Was der Pflichtteil bedeutet
Weiterlesen
Aufgepasst: 10 häufige Fehler rund ums Testament
Weiterlesen
Auf Nummer sicher: So bewahren Sie Ihr Testament richtig auf
Weiterlesen
Nutzen Sie die kostenfreien Webinare von Testament-und-Erbe.de. Erfahrene Rechtsanwälte und Fachanwälte für Erbrecht Informieren Sie über die wichtigsten Aspekte bel der Regelung von Erbschaften, weisen auf häufige Fehler hin und helfen Ihnen, Angehörige abzusichern sowie Erbschaftssteuern zu sparen.