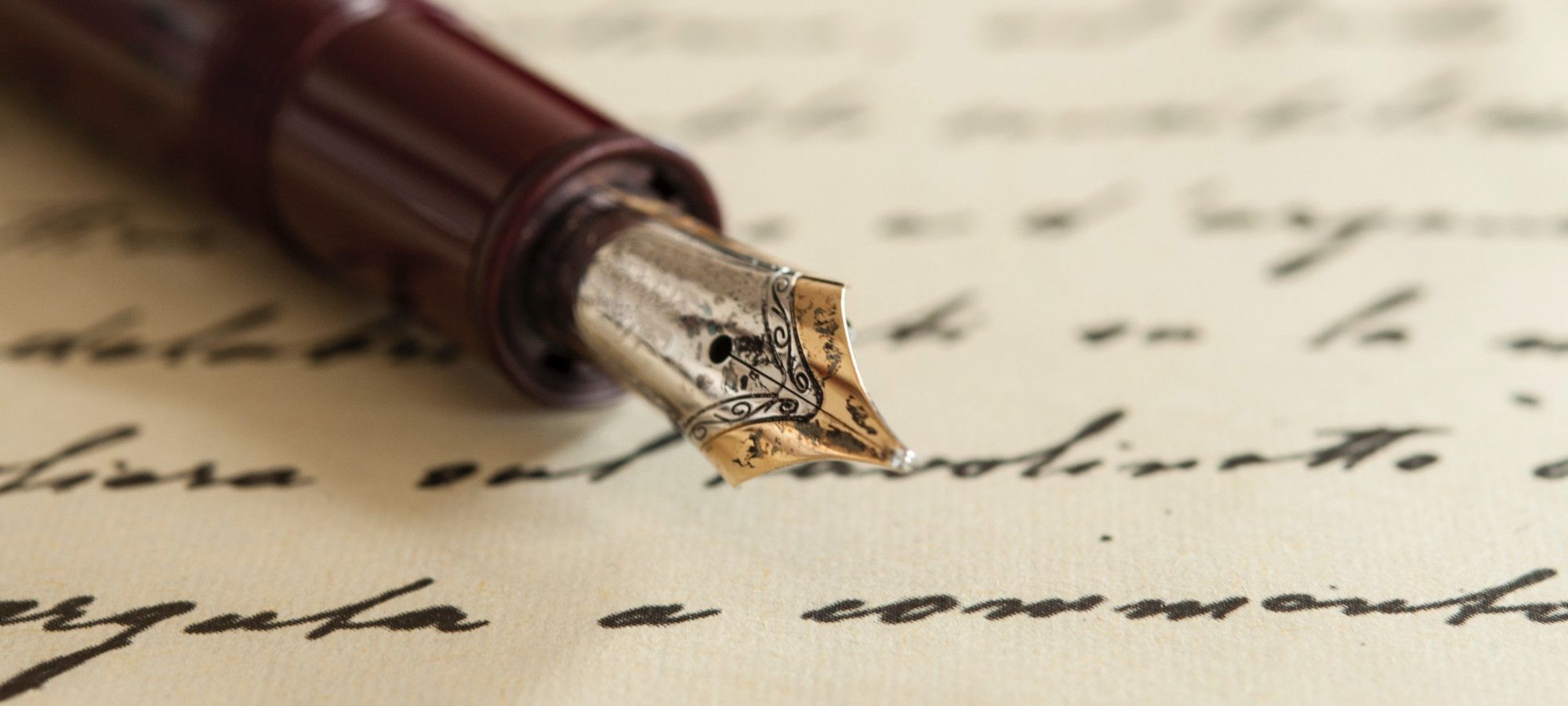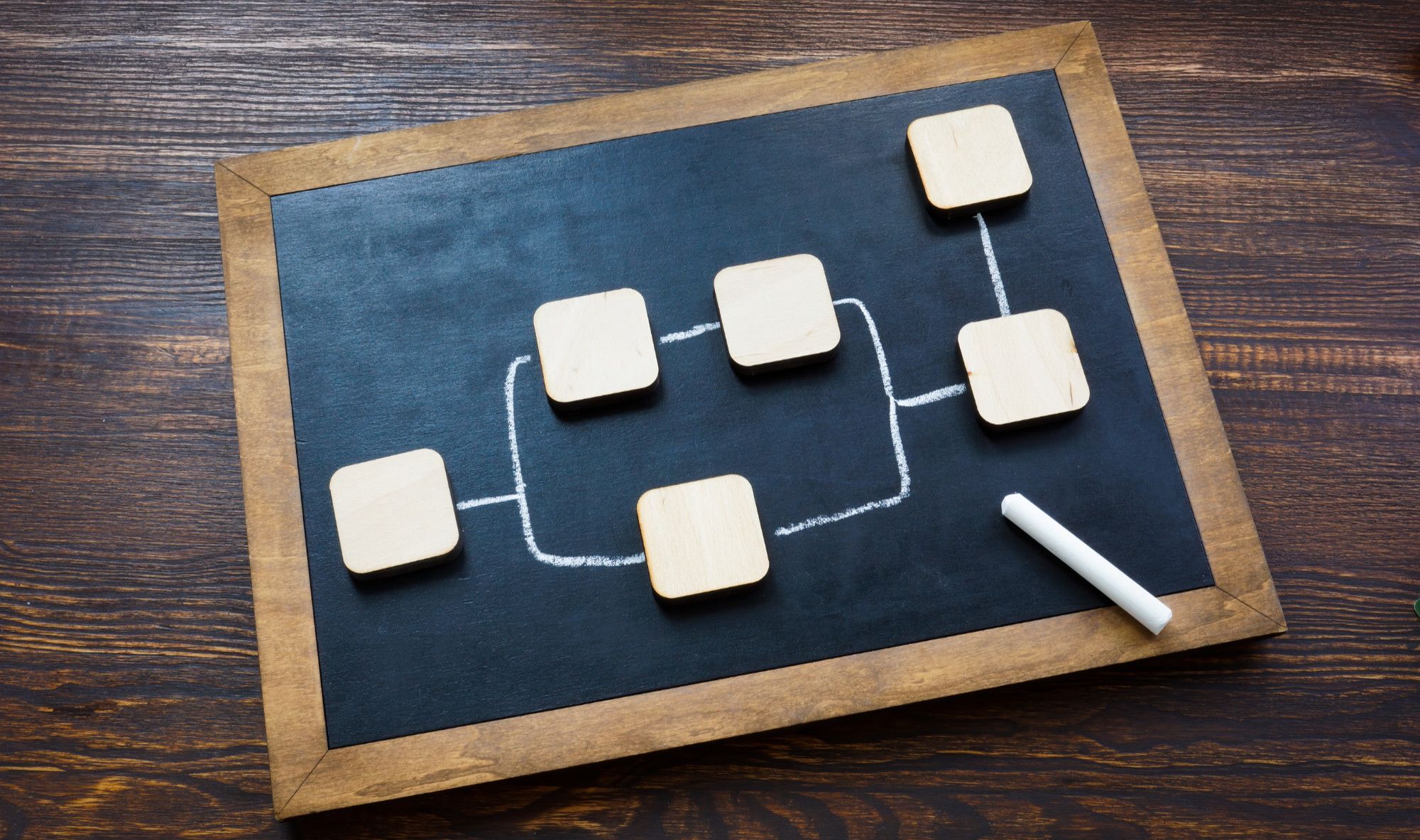Vorerbe, Nacherbe und Schlusserbe
Mit der Festlegung einer Vor- und Nacherbschaft beschränkt man die Verfügungsgewalt der zunächst Erbenden im Interesse späterer Erben. Allerdings hat diese oft aus Fürsorge heraus getroffene Regelung auch ihre Tücken.

Vor- und Nacherbe: Es hat nichts mit der gesetzlichen Erbfolge zu tun
In Texten über erbrechtliche Fragen wimmelt es von Wörtern, die nicht jedem vertraut sind. So gibt es neben dem wohl allseits bekannten Erben die Begriffe „Vorerbe“, „Nacherbe“ und „Schlusserbe“. Über die Bedeutung sind sich viele nicht im Klaren, auch Irrtümer sind nicht selten, beispielsweise dass Vor- und Nacherben etwas mit der gesetzlichen Erbfolge zu tun haben.
Vor- und Nacherbschaft sind das Ergebnis einer Festlegung
Was bedeuten die Begriffe also? Zunächst muss man verstehen, dass eine Vor- und Nacherbschaft nicht automatisch entsteht, sondern immer das Ergebnis einer Festlegung ist, ob nun im Testament oder im Erbvertrag. Hauptmotiv für diese Festlegung ist meist der Wunsch des Erblassers, jemanden besonders wirksam abzusichern oder ein Vermögen zu schützen. Eine als Vorerbe benannte Person darf die Erbschaft bis zu ihrem Tod oder bis zu einem anderen, vorher festgelegten Zeitpunkt nutzen. Dann geht das Erbe an den oder die Nacherben über. Damit die am Ende nicht leer ausgehen, wird also die Verfügungsgewalt des Vorerben über das Vermögen eingeschränkt. Allerdings gibt es auch den sogenannten befreiten Vorerben: Ein befreiter Vorerbe wird vom Erblasser von bestimmten Verpflichtungen und Verfügungsbeschränkungen befreit. Diese müssen aber ebenfalls genau definiert werden. Hier können Sie mehr über Vor- und Nacherbe sowie über die befreite Vorerbschaft erfahren.
Ein häufiger Fall für eine Vor- und Nacherbenregelung findet sich in Ehegattentestamenten: Hier soll zum einen der länger lebende Ehepartner abgesichert werden, andererseits soll auch sichergestellt werden, dass die Kinder später in den Genuss des Erbes kommen.
Allerdings weisen viele privat erstellte Testamente inhaltliche Mängel auf, die zu Unsicherheiten bei der Auslegung führen. Gerade bei Regelungen zur Vor- und Nacherbschaft gibt es häufig Unklarheiten. Dazu kommt das Risiko einer möglichen steuerlichen Belastung der Nacherben, die vom Erblasser gar nicht beabsichtigt war. Es ist daher ratsam, im Zweifelsfall juristische Hilfe in Anspruch zu nehmen, bevor man eine Vor- und Nacherbenregelung trifft.
Alternativen
Die mit der Vor- und Nacherbschaft verbundenen Nachteile motivieren viele dazu, eine andere Lösung zu wählen. Besonders beliebt ist das sogenannte Berliner Testament, eine Form des Ehegattentestaments, in dem der länger lebende Ehegatte zum Alleinerben wird, der keinerlei Einschränkungen und Vorgaben unterliegt, was den Nachlass angeht. Nach seinem Tod erben dann die Kinder als Schlusserben.
Eine andere Möglichkeit ist, jemanden nicht als Nacherben, sondern als ganz normalen Erben zu benennen. Die Person, die sonst Vorerbe geworden wäre, erhält zum Ausgleich ein Nutzungsrecht, beispielsweise ein Nießbrauchsrecht an einer Immobilie. Auch hier kann fachmännische Beratung dabei helfen, eine individuell passende Lösung zu finden.

Alles zum Thema Testament
Der Einstieg in Deutschlands beliebteste Erbregelung
- Testaments-Generator
- Testamentsprüfung
- Pflichtteil
- Immobilien vererben
- Erbschafts-Steuern
Passende Webinare
Weitere Webinare
Mehr zu diesem Thema

Das Testament - die klassische Erbfolgeregelung
Weiterlesen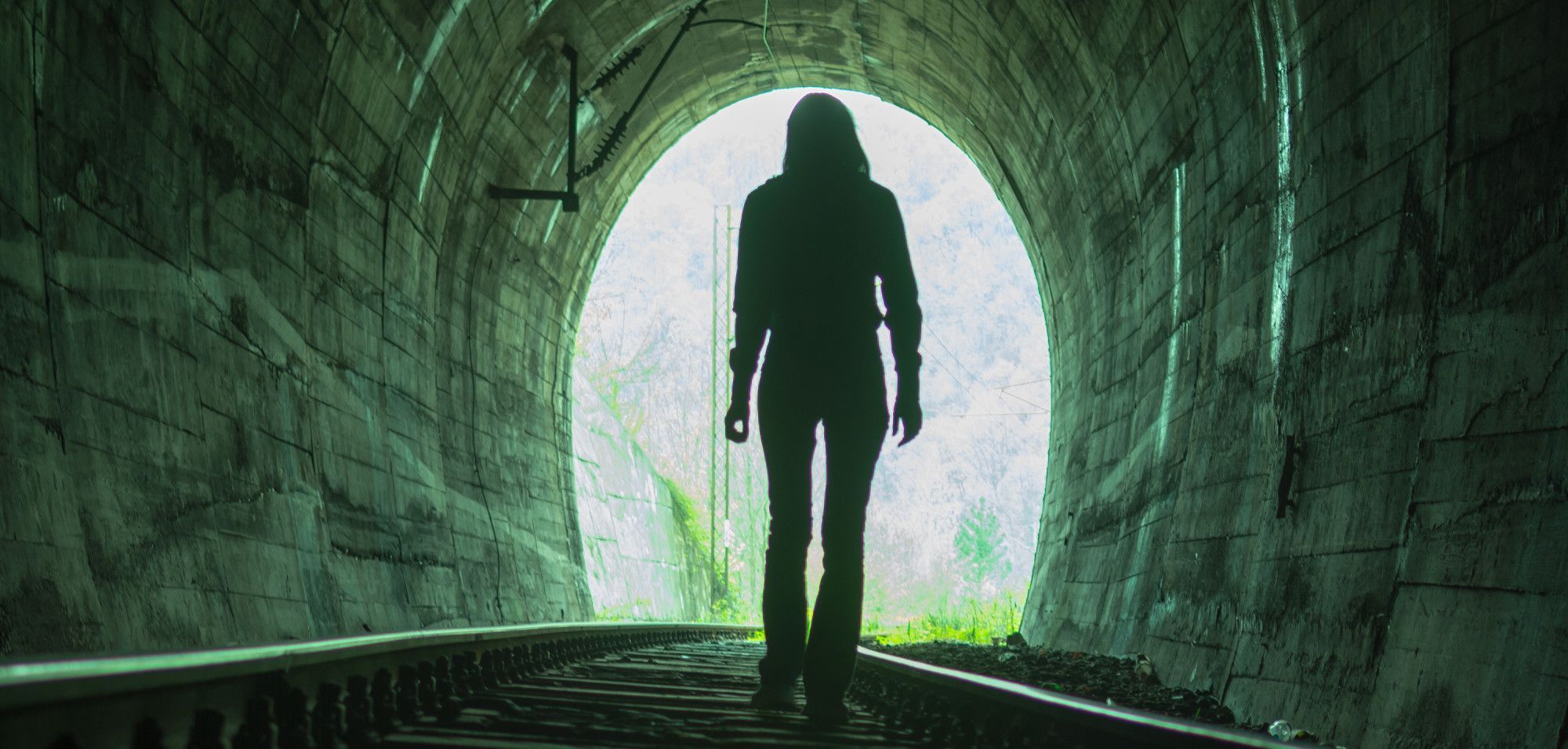
Du bist enterbt! Was der Pflichtteil bedeutet
Weiterlesen
Aufgepasst: 10 häufige Fehler rund ums Testament
Weiterlesen
Auf Nummer sicher: So bewahren Sie Ihr Testament richtig auf
Weiterlesen
Nutzen Sie die kostenfreien Webinare von Testament-und-Erbe.de. Erfahrene Rechtsanwälte und Fachanwälte für Erbrecht Informieren Sie über die wichtigsten Aspekte bel der Regelung von Erbschaften, weisen auf häufige Fehler hin und helfen Ihnen, Angehörige abzusichern sowie Erbschaftssteuern zu sparen.