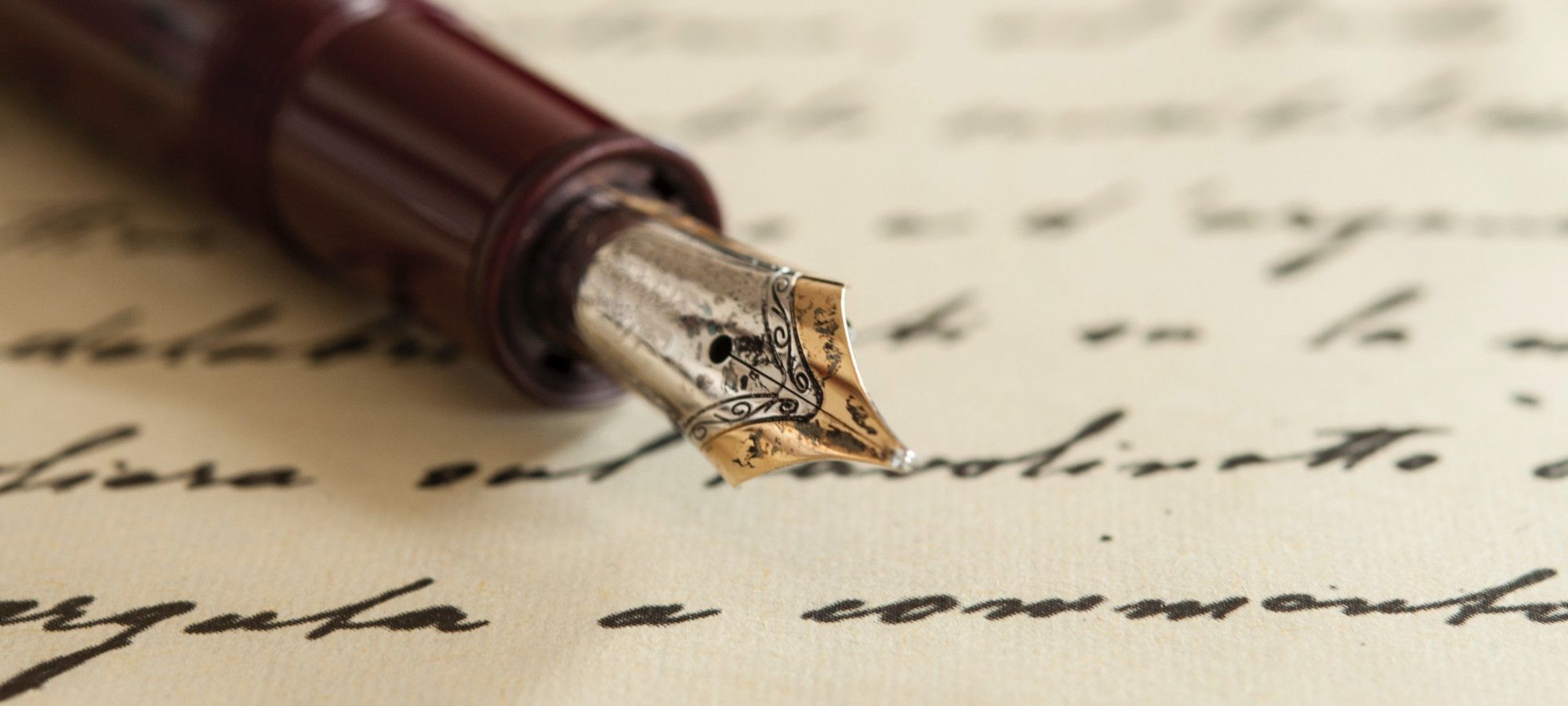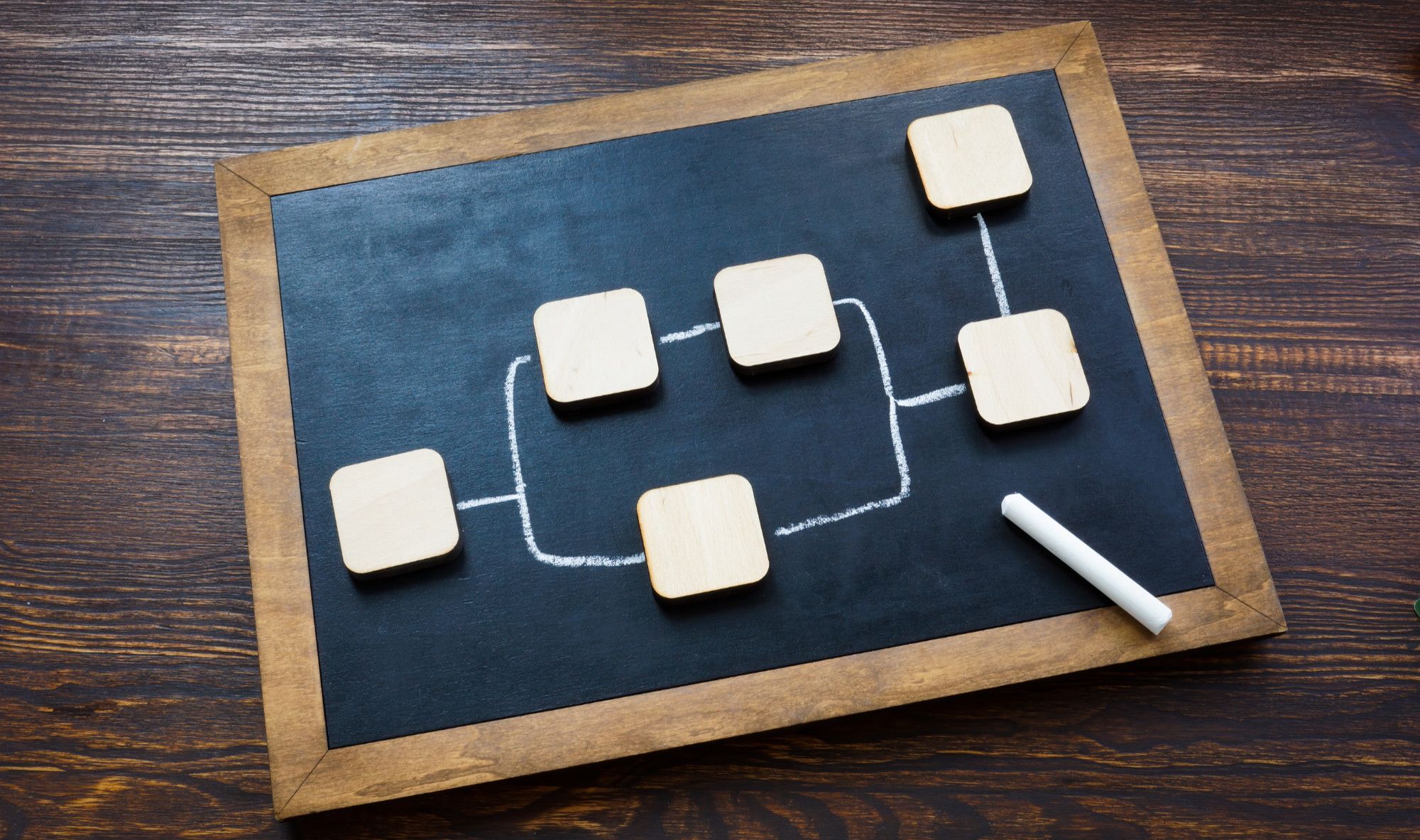Das Testament - die klassische Erbfolgeregelung
Das Testament ist die wohl bekannteste Form der Nachlassregelung. Allerdings gibt es auch hier ganz unterschiedliche Kategorien und Optionen.

Mit einem Testament kann man detailliert festlegen, wie das Vermögen nach dem eigenen Tod aufgeteilt werden und wer welchen Teil des Vermögens erhalten soll. Bei Bedarf lässt sich das Erbe zudem an konkrete Bedingungen knüpfen.
Das Testament ist einerseits die bekannteste Art der Nachlassregelung, andererseits passieren hier vermutlich die meisten Fehler. Und die können gravierende Folgen haben – entweder ist ein Testament dann von vornherein ungültig, oder es gibt Auswirkungen, die gar nicht beabsichtigt waren. Hier lohnt es sich, im Zweifelsfall professionelle Beratung in Anspruch zu nehmen. Wichtige Hinweise erhalten Sie auch in unserem Beitrag 10 gängige Fehler rund ums Testament.
Das privatschriftliche oder eigenhändige Testament
Ein privatschriftliches oder eigenhändiges Testament ist eine besondere Form des Testaments, die in Deutschland und vielen anderen Ländern anerkannt wird. Es hat den Vorteil, dass es jederzeit und ohne formelle Anforderungen geändert oder widerrufen werden kann. Es muss jedoch immer handschriftlich verfasst sein und von der Person, die es erstellt hat, unterschrieben werden. Ist dies nicht der Fall, ist das Testament automatisch ungültig!
Ein privatschriftliches Testament können Sie bei sich zuhause aufbewahren. Sie sollten allerdings sicherstellen, dass es an einem sicheren Platz deponiert ist. Zudem sollten Sie mindestens eine Person Ihres Vertrauens über den Aufbewahrungsort informieren oder auf andere Art Vorsorge treffen, dass Ihr Testament im Fall Ihres Todes auch gefunden wird. Lesen Sie dazu auch den Artikel Auf Nummer sicher: So bewahren Sie Ihr Testament richtig auf.
Das öffentliche oder notarielle Testament
Ein öffentliches bzw. notarielles Testament wird von einem Notar aufgenommen und beglaubigt, oder ein bereits geschriebenes Testament wird notariell auf mögliche Fehler oder Unstimmigkeiten überprüft, ggf. korrigiert und dann beglaubigt. Die notarielle Beurkundung beinhaltet auch die Feststellung, dass das Testament freiwillig und ohne Druck oder Beeinflussung errichtet wurde und der Erblasser geschäftsfähig und bei klarem Verstand ist. Damit lässt sich vermeiden, dass Erben oder Pflichtteilsberechtigte das Testament später anfechten können.
Notarielle Testamente haben zudem den Vorteil, dass sie grundsätzlich beim Nachlassgericht hinterlegt und ins Zentrale Testamentsregister eingetragen werden.
Das gemeinschaftliche Testament oder Ehegattentestament
Mit einem gemeinschaftlichen Testament können Verheiratete und eingetragene Lebenspartner ihren Nachlass gemeinsam regeln. Ein wichtiges Motiv für ein gemeinschaftliches Testament ist oft die Absicherung des länger lebenden Partners – das Testament verhindert so, dass auf der Basis der gesetzlichen Erbfolge andere Angehörige erben. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, ein gemeinschaftliches Testament zu errichten:
- Bei einem gleichzeitigen gemeinschaftlichen Testament handelt es sich um zwei Einzeltestamente, die unabhängig voneinander erstellt wurden. Entsprechend sind beide Dokumente nicht aufeinander abgestimmt. Bei dieser Form geht es nicht darum, sich gegenseitig als Erben einzusetzen.
- Anders ist das beim gegenseitigen Testament: Hier werden ebenfalls zwei Einzeltestamente angefertigt, aber die Partner setzen sich gegenseitig als Erben oder Vermächtnisnehmer ein.
- Die dritte Form des gemeinschaftlichen Testaments ist wohl die geläufigste: das wechselbezügliche Testament. Dieses wird von beiden Ehegatten gemeinsam errichtet und unterzeichnet. Das bedeutet, beide müssen übereinstimmend entscheiden, wie ihre Vermögenswerte nach dem Tod des ersten Ehegatten verteilt werden sollen.
Das wechselbezügliche Testament hat den Vorteil, dass die gemeinsamen Wünsche beider Ehepartner berücksichtigt sind. Auch Änderungen lassen sich jederzeit vornehmen, solange beide Ehepartner noch leben. Ist allerdings ein Ehepartner bereits gestorben, kann der andere keine Änderungen am gemeinschaftlichen Testament mehr vornehmen. Daher sollte der Inhalt des gemeinschaftlichen Testaments sorgfältig erwogen und im Zweifelsfall rechtlicher Rat eingeholt werden.
Was passiert bei einer Scheidung?
Sobald eine Ehe durch ein rechtskräftiges Scheidungsurteil geschieden ist, wird ein gemeinschaftliches Testament unwirksam. Das Gleiche gilt für den Fall, dass ein Ehepartner selbst die Scheidung beantragt oder dem Scheidungsantrag des anderen Partners zugestimmt hat und dann stirbt. Allerdings können einige Verfügungen weiterhin ihre Gültigkeit behalten, besonders wenn anzunehmen ist, dass sie auch für den Fall einer Scheidung getroffen worden wären. Dies kann im Einzelfall aber schwer nachzuweisen sein, sofern es keine klaren Regelungen für den Fall einer Scheidung oder Trennung enthält. Aus diesem Grund sollte man nach einer Ehescheidung das gemeinschaftliche Testament überprüfen und es bei Bedarf ganz oder in Teilen notariell widerrufen.
Das „Berliner Testament“
Eine Sonderform des Ehegattentestaments ist das „Berliner Testament“: Darin setzen sich die Partner gegenseitig als Alleinerben ein. Beim Tod eines Partners erbt der hinterbliebene Partner das ganze Vermögen. Nach dessen Tod geht dann der beiderseitige Nachlass an Dritte über – in vielen Fällen sind das die Kinder. Falls die Kinder vorher bereits Teile des Vermögens erhalten sollen, können die Partner dies im Rahmen von Vermächtnissen regeln. Die Kinder haben in dem Fall keinen Erbenstatus und somit auch kein Mitspracherecht in Bezug auf den Nachlass. Darüber hinaus bedeutet eine Regelung nach dem Berliner Testament, dass der länger lebende Partner frei über das Erbe verfügen kann; er oder sie hat keinerlei Verpflichtung gegenüber den als Schlusserben eingesetzten Kindern oder anderen Personen.
Eine Variante des Berliner Testaments ist die sog. Trennungslösung, bei der das Vermögen des zuerst verstorbenen Partners einer Verfügungsbeschränkung unterliegt. Der hinterbliebene Partner hat als Vorerbe damit nur eingeschränkten Zugriff auf das Erbe, das im Interesse der Nacherben geschützt wird.
Auch für das Berliner Testament gilt, dass es nach dem Tod eines der beiden Partner nicht mehr geändert werden kann. Sind beispielweise die Kinder als Schlusserben eingesetzt, lässt sich dies nachträglich nicht mehr ändern.
Das Berliner Testament kann zudem ungünstige steuerliche Konsequenzen haben: Vermögen, dessen Wert die steuerlichen Freibeträge übersteigt, unterliegt einer Doppelbesteuerung – zunächst, wenn der hinterbliebene Partner erbt, und dann noch einmal, wenn nach dessen Tod die Kinder (oder andere Personen) erben.
Generell gilt: Unvorhergesehene steuerliche Belastungen, Erbschaftsstreitigkeiten und Anfechtungen: bei gemeinschaftlichen Testamenten ist das Risiko unerwünschter Auswirkungen leider sehr hoch, daher ist es ratsam, sich anwaltlich beraten zu lassen.

Werkzeuge und Leistungen
Erstellen Sie einfach und kostenfrei Ihr Testament mit unserem Testaments-Generator
Alles richtig gemacht? Wir prüfen Ihr Testament
Berliner Testament oder gesetzliche Erbfolge? Steuerbelastung vergleichen

Informationen rund ums Testament
-
Wenn ein normales Testament nicht ausreicht: Sonderformen letztwilliger Verfügungen
-
Was ist das beste Regelungs-Instrument? Optimale Absicherung mit Immobilien
Fragen zum Testament?
Buchen Sie ein kostenfreies Beratungsgespräch mit unseren Nachlass-Experten:
Passende Webinare
Weitere Webinare
Mehr zu diesem Thema
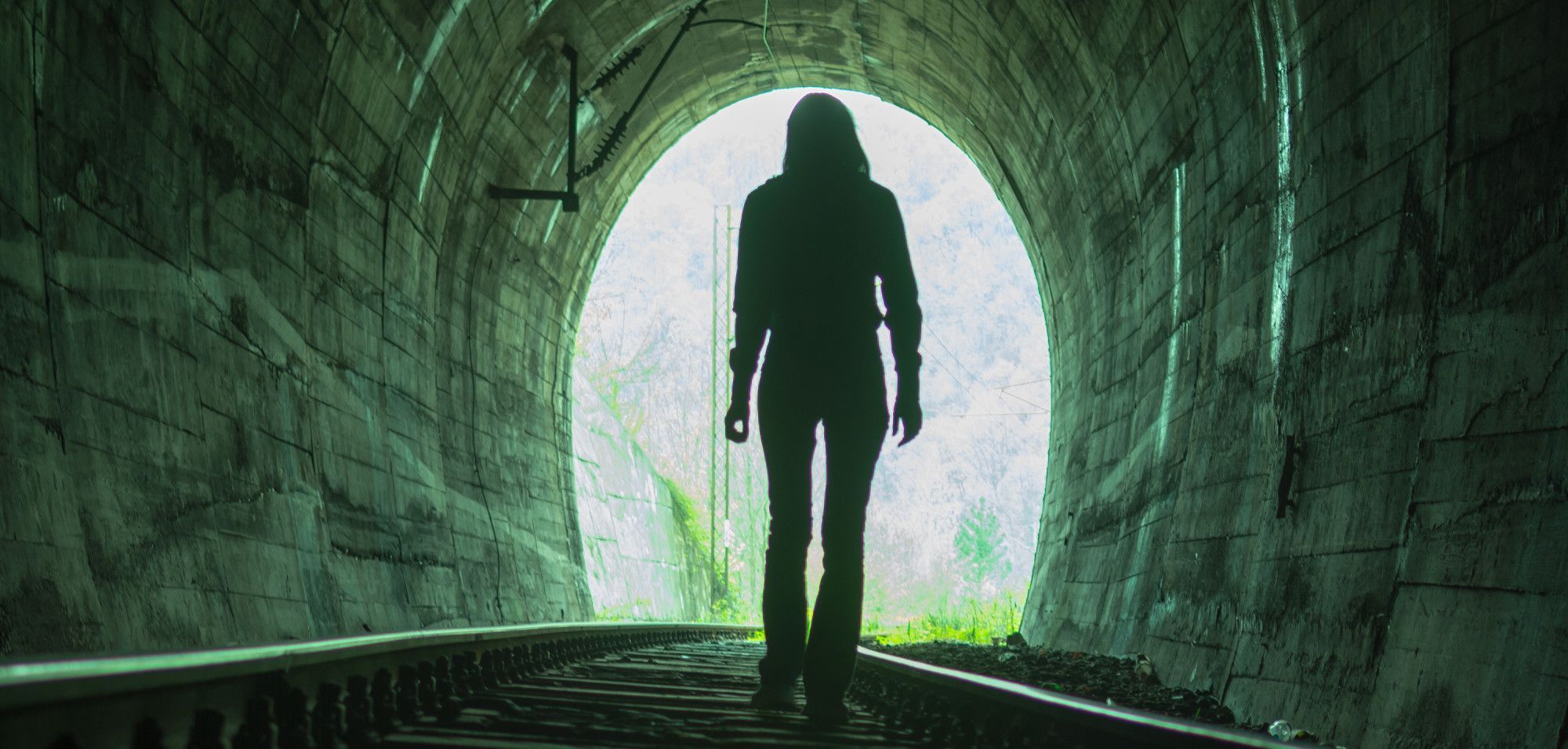
Du bist enterbt! Was der Pflichtteil bedeutet
Weiterlesen
Aufgepasst: 10 häufige Fehler rund ums Testament
Weiterlesen
Auf Nummer sicher: So bewahren Sie Ihr Testament richtig auf
Weiterlesen
Ist ein Testament wirklich das Richtige? So behalten Sie die Kontrolle bei der Nachlass-Regelung
Weiterlesen
Nutzen Sie die kostenfreien Webinare von Testament-und-Erbe.de. Erfahrene Rechtsanwälte und Fachanwälte für Erbrecht Informieren Sie über die wichtigsten Aspekte bel der Regelung von Erbschaften, weisen auf häufige Fehler hin und helfen Ihnen, Angehörige abzusichern sowie Erbschaftssteuern zu sparen.