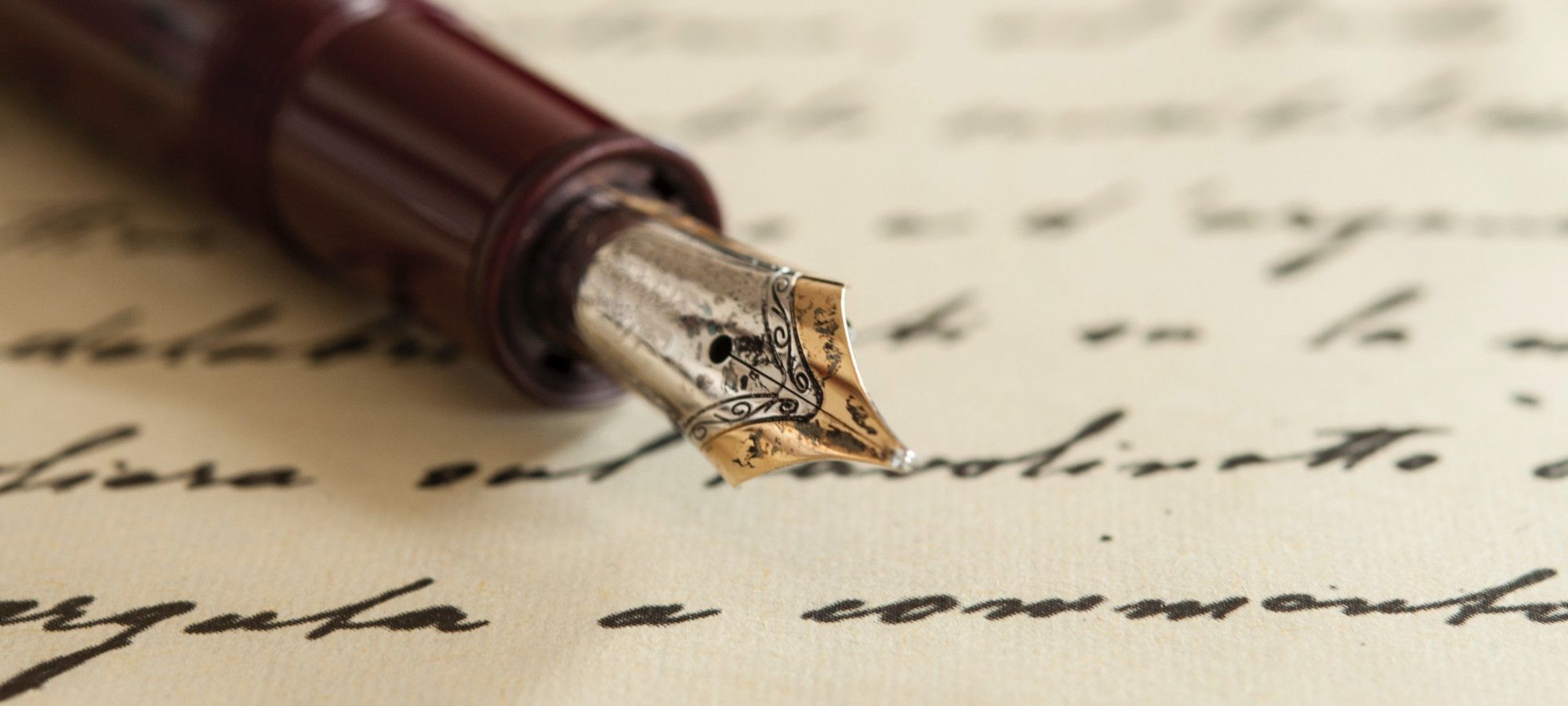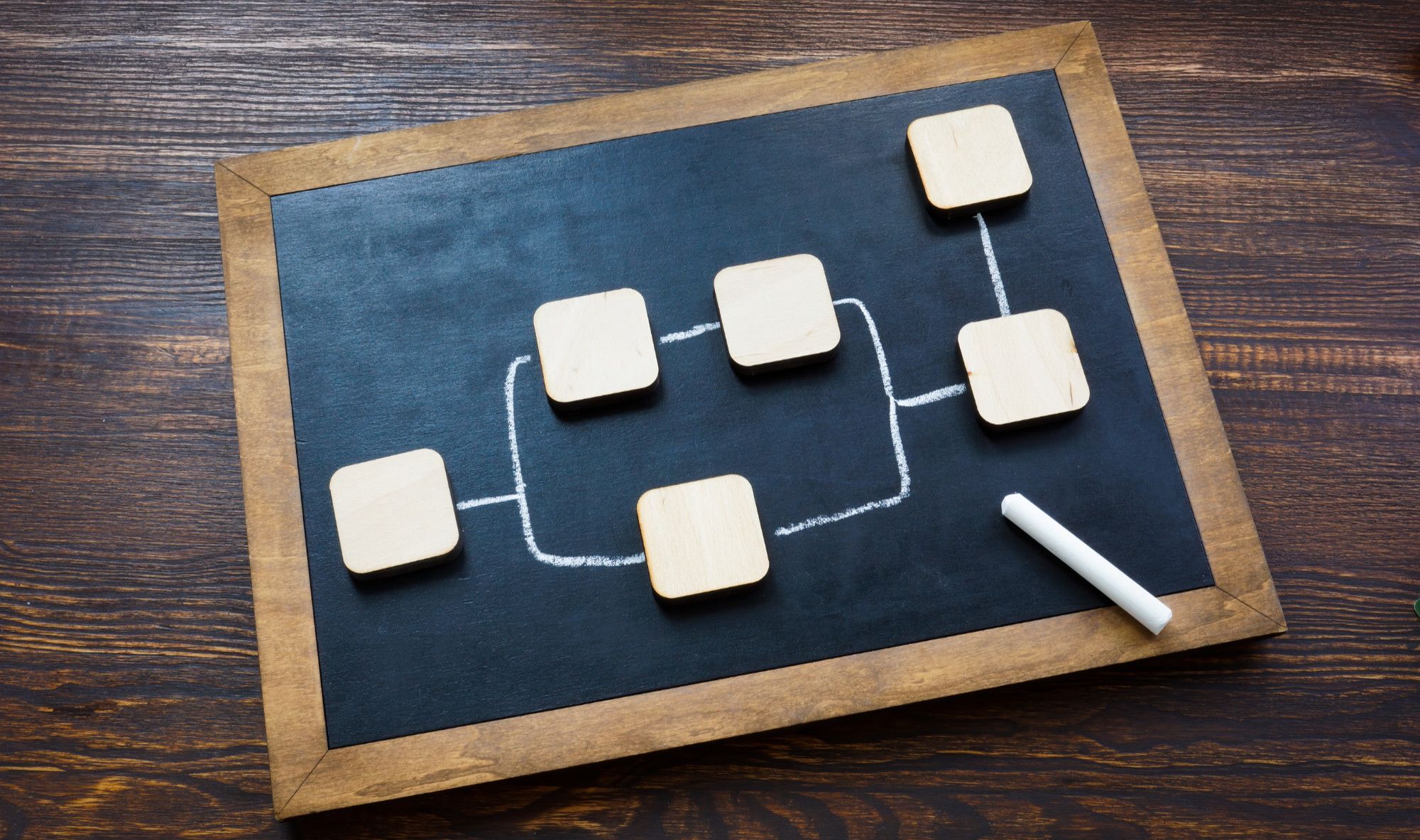Welche Folgen hat eine Enterbung?
Wer einen Familienangehörigen von der durch das Gesetz festgelegten Erbfolge ausschließen will, kann dies per Testament anordnen. Dabei sollte man nicht vergessen, dass manche Personen aus der engeren Verwandtschaft Anspruch auf einen Pflichtteil haben.

Stirbt ein Mensch, so gilt in Deutschland die gesetzliche Erbfolge: In ihr ist festgelegt, wer das Erbe erhält. Erbberechtigt sind demnach ein länger lebender Ehepartner und die Kinder des Verstorbenen. Hat ein Verstorbener keine Kinder mehr, weil diese bereits gestorben sind, rücken die Enkel als Erben nach. Wenn jemand allerdings testamentarisch verfügt, dass bestimmte erbberechtigte Verwandte enterbt werden sollen, so ist das sein gutes Recht. Jeder Mensch kann frei bestimmen, wer sein Erbe erhält. Dies bedeutet allerdings nicht zwangsläufig, dass eine enterbte Person gar nichts erhält.
Was bekommt eine enterbte Person?
Die Enterbung führt dazu, dass die enterbte Person ihren Erbenstatus verliert. Wer besonders eng mit dem Verstorbenen verwandt ist (hierzu zählen der länger lebende Ehe- oder eingetragene Lebenspartner, die Kinder und unter bestimmten Umständen auch die Eltern eines Verstorbenen) erhält als Ersatz für den Wegfall des Erbenstatus einen Anspruch auf einen Pflichtteil am Erbe. Aus einem vormaligen Erben wird ein Pflichtteilsberechtigter. Der weit verbreitete Glaube, dass ein Enterbter nichts bekommt, ist also falsch. Der neu entstandene Pflichtteilsanspruch richtet sich jetzt gegen denjenigen, der das Erbe erhalten hat.
Erfahren Sie mehr über den gesetzlichen Pflichtteil sowie über den Pflichtteilsergänzungsanspruch bei Schenkung und Übertragung.
Gibt es auch Fälle, in denen das Pflichtteilsrecht entzogen werden kann?
Ja, die gibt es. Das Gesetz hat hier eine gute Handvoll Gründe festgeschrieben, die zum Entzug des Pflichtteils führen können. Dazu zählen beispielsweise Handlungen, die in erheblichem Maße gegen Leib und Leben des Erblassers oder naher Angehöriger gerichtet sind. Viele mögen es als ungerecht empfinden, aber ein Kind, zu dem man über Jahrzehnte keinen Kontakt hat, ist sowohl erb- als auch pflichtteilsberechtigt. Es müssen eindeutige und strafbare Handlungen vorliegen, um das Pflichtteilsrecht zu entziehen. Zudem liegt die Beweispflicht bei der Person, die eine Pflichtteilsentziehung geltend macht. Bei weiter zurückliegenden Ereignissen kann das schwer werden, insbesondere wenn keine Anzeige und keine gerichtliche Aufarbeitung erfolgt ist.
Passende Webinare
Weitere Webinare
Mehr zu diesem Thema

Das Testament - die klassische Erbfolgeregelung
Weiterlesen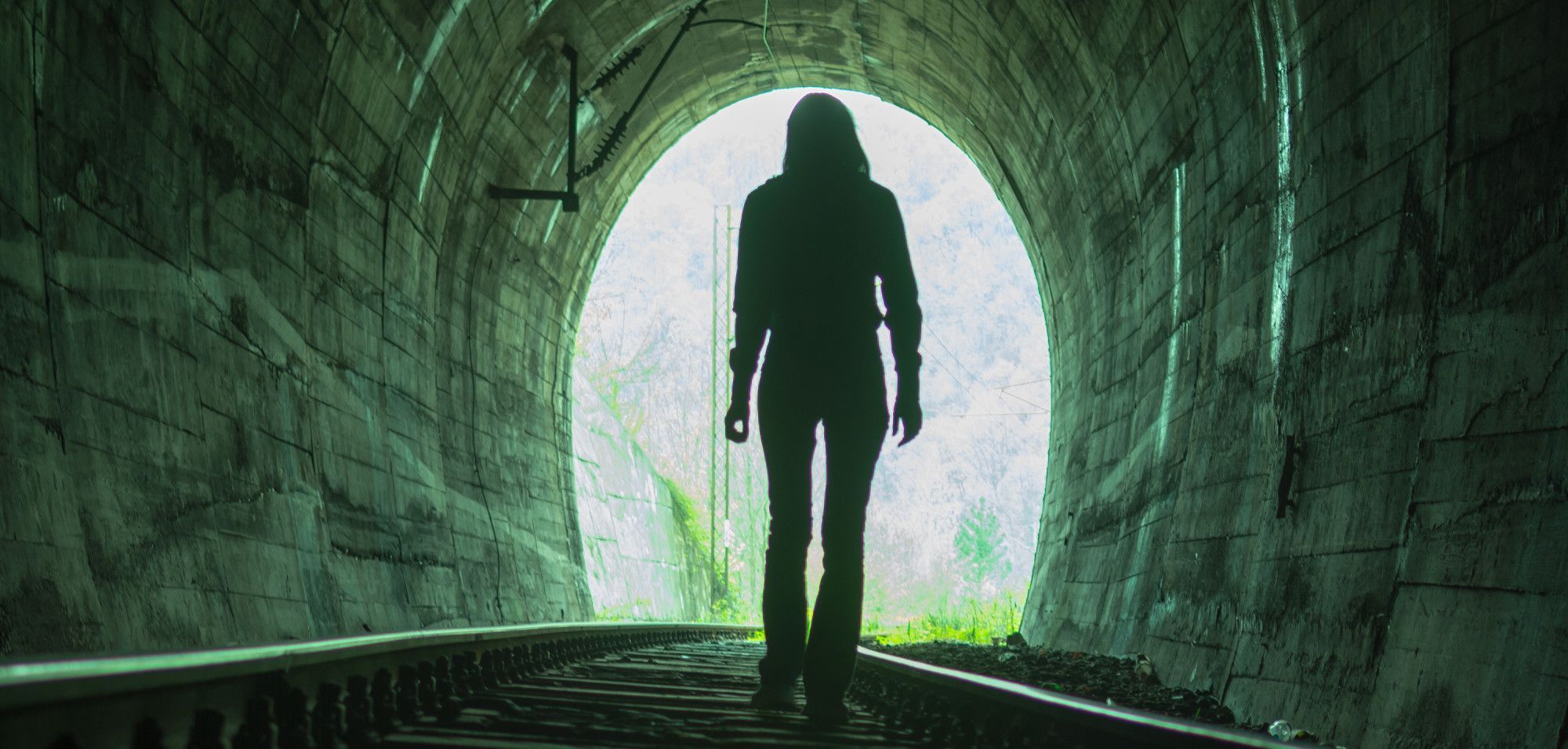
Du bist enterbt! Was der Pflichtteil bedeutet
Weiterlesen
Aufgepasst: 10 häufige Fehler rund ums Testament
Weiterlesen
Auf Nummer sicher: So bewahren Sie Ihr Testament richtig auf
Weiterlesen
Nutzen Sie die kostenfreien Webinare von Testament-und-Erbe.de. Erfahrene Rechtsanwälte und Fachanwälte für Erbrecht Informieren Sie über die wichtigsten Aspekte bel der Regelung von Erbschaften, weisen auf häufige Fehler hin und helfen Ihnen, Angehörige abzusichern sowie Erbschaftssteuern zu sparen.